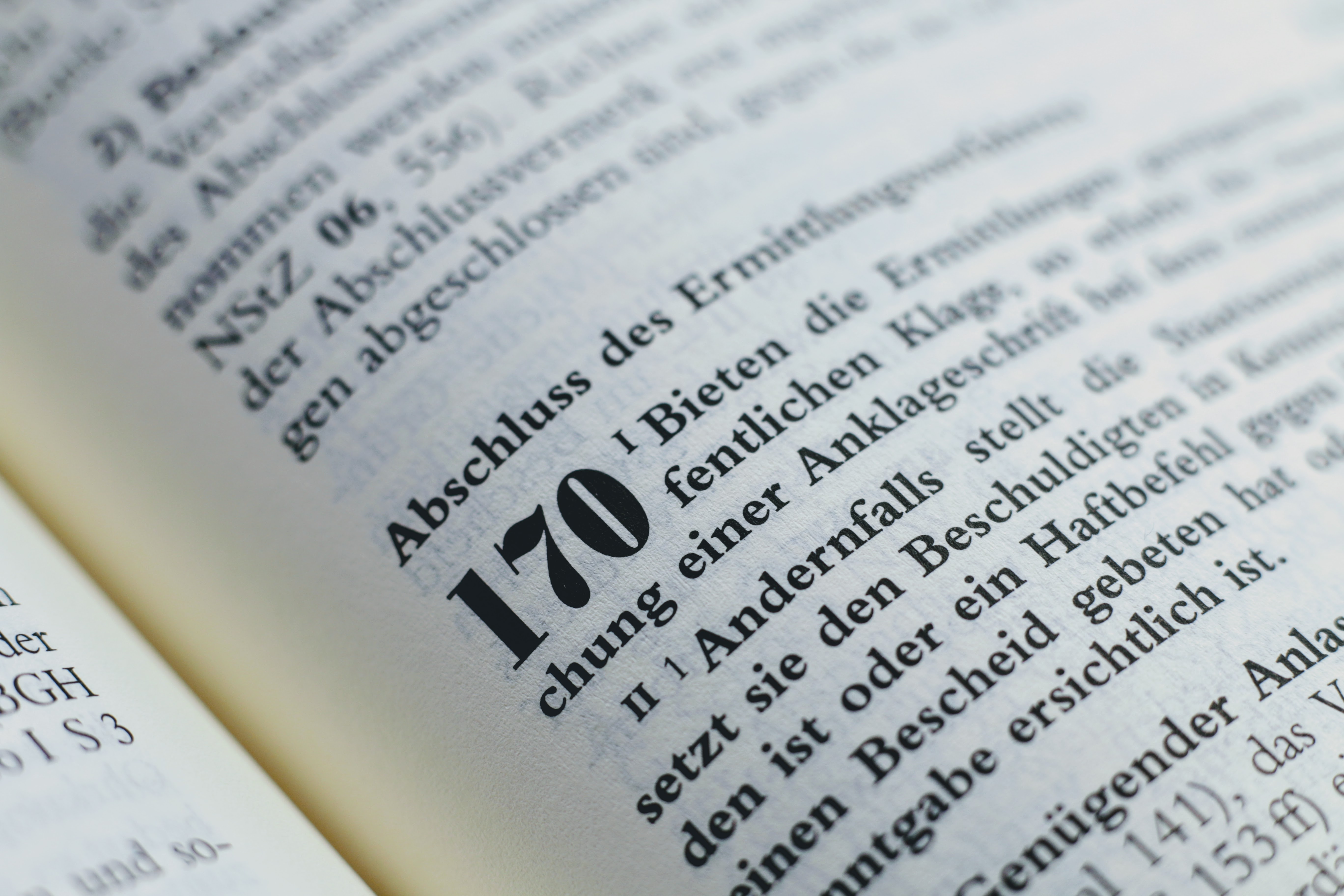Einstellung § 154 StPO

Was bedeutet die Einstellung gem. § 154 StPO?
Nicht selten erhält man als Geschädigter oder als Beschuldigter einer Straftat von der Staatsanwaltschaft folgende Nachricht:
"Das Verfahren wurde nach § 154 StPO eingestellt."
Was bedeutet das?
Die Staatsanwaltschaft ist grundsätzlich verpflichtet, bei dem Verdacht einer Straftat ein Ermittlungsverfahren einzuleiten und die Tat zu verfolgen. Erhärten die Ermittlungen den Tatverdacht, muss die Staatsanwaltschaft Anklage erheben oder einen Strafbefehl beantragen - dann geht die Sache ans Gericht und der Täter, dort kommt es ggf. zur Bestrafung des Täters. Wird der Verdacht hingegen nicht bestätigt oder kann die Straftat aus anderen Gründen nicht verfolgt werden, ist das Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO einzustellen. Eine solche Einstellung ist folgenlos.
Zwischen diesen beiden Polen gibt es aber noch andere Möglichkeiten, ein Ermittlungsverfahren zu beenden:

Voraussetzung einer Einstellung nach § 154 StPO
In der Praxis sehr wichtig ist die Einstellung nach § 154 Abs. 1 StPO, danach kann die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung der Tat absehen, wenn
- die Strafe , die im Falle einer Verurteilung zu erwarten ist, neben einer anderen rechtskräftigen Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fällt (vgl. § 154 Abs. 1 Nr. 1 StPO)
oder
- wenn eine Verurteilung so bald nicht zu erwarten ist und der Täter schon wegen einer anderen Sache verurteilt wurde bzw. eine Strafe zu erwarten hat und eine weitere Einwirkung auf den Täter zur Verteidigung der Rechtsordnung ausreichend erscheint (vgl. § 154 Abs. 1 Nr. 2 StPO).
§ 154 StPO: "Das macht den Braten nicht fett"
Kennen Sie das Sprichwort: "Das macht den Braten nicht fett"? Dann haben Sie die Kernaussage des § 154 StPO bereits verstanden. § 154 StPO erledigt einfach Teile eines Ermittlungsverfahrens, die im Ergebnis nicht ins Gewicht fallen würden.
Ein Beispiel:
Der Täter wurde in einem anderen Strafverfahren bereits wegen eines Raubes rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Nun ist noch ein anderes Ermittlungsverfahren wegen eines Ladendiebstahls offen. Würde der Täter wegen dieses Ladendiebstahls verurteilt, dann würde die zu erwartende Strafe neben der schon verhängten Strafe unbedeutend sein. Der Aufwand, das Ermittlungsverfahren weiter zu betreiben und evtl. eine neue Hauptverhandlung anzustrengen, würde sich nicht lohnen. Deshalb kann der Staatsanwalt das Verfahren nach § 154 StPO einstellen.
Das Beispiel ist natürlich ein wenig extrem. Für die Einstellung gem. § 154 StPO muss das Missverhältnis zwischen den Taten (Raub auf der einen, Ladendiebstahl auf der anderen Seite) nicht so extrem sein. Es verdeutlicht aber, worum es bei § 154 StPO geht.
Bei der zweiten Variante der Vorschrift (§ 154 Abs. 1 Nr. 2 StPO) verhält es sich ähnlich, nur dass es in diesem Fall nicht einmal erforderlich ist, dass die zweite zu erwartende Strafe neben der schon erfolgten Verurteilung “nicht ins Gewicht fällt”. Für die einzustellende Tat kann deshalb durchaus eine erhebliche Strafe zu erwarten sein – es genügt für die Einstellung, dass dieses Urteil nicht so bald zu erwarten ist, etwa weil vor einer Anklageerhebung noch umfangreiche Ermittlungen durchzuführen wären. Im Ergebnis laufen beide Varianten auf das Gleiche hinaus: Das Verfahren ist eingestellt, die Sache ist damit erledigt (kann allerdings grundsätzlich wieder aufgenommen werden).
Hintergrund: Die Verfahrenseinstellung gem. § 154 StPO zählt zu den sogenannten Opportunitätseinstellungen (wie z.B. auch § 153, § 153 a StPO. Opportun bedeutet hier so viel wie "angebracht, angemessen" oder auch "zweckmäßig". Für die Strafverfolgungsbehörden ist es in diesen Fällen angemessen und zweckmäßig, die Sache nicht weiter zu verfolgen - schließlich gibt es noch andere Straftaten, die aufgeklärt und verfolgt werden müssen. Es macht deshalb Sinn, die knappen Ressourcen zu bündeln und sich auf die Fälle zu konzentrieren, bei denen es einen Unterschied macht, ob man die Sache weiter verfolgt oder nicht.
Was kann der Geschädigte gegen eine Einstellung nach § 154 StPO tun?
Während die Einstellung für den Beschuldigten in den meisten Fällen positiv ist (er hat allerdings noch andere Probleme), stellt sich für den Geschädigten der Straftat bzw. das Opfer der Straftat die Frage, ob er was gegen die Einstellung des Verfahrens nach § 154 StPO tun kann. Denn die Einstellung hat zur Folge, dass seine Straftat nicht weiter verfolgt wird – wenn er Strafantrag gestellt hat, hat sich dieser erledigt. Die Antwort ist allerdings eindeutig: Der Geschädigte einer Straftat hat gegen die Einstellung nach § 154 StPO keine Rechtsschutzmöglichkeiten, er kann also nicht Beschwerde einlegen oder die Entscheidung sonst wie gerichtlich überprüfen lassen. Ihm bleibt nur, ggf. Ansprüche im Zivilverfahren geltend zu machen, denn zivilrechtliche Ansprüche bleiben von der Einstellungsentscheidung natürlich unberührt. Anders als bei einer Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO kann der Geschädigte bzw. Verletzte auch nicht das Klageerzwingungsverfahren anstrengen. Ihm bleibt nur, die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zu akzeptieren oder informelle Rechtsbehelfe zu ergreifen. Zu nennen wären hier die Dienstaufsichtsbeschwerde oder auch eine Gegenvorstellung. Beide dürften jedoch nur in Ausnahmefällen Aussicht auf Erfolg haben.
Insgesamt mag die Einstellung nach § 154 StPO für den Geschädigten unbefriedigend sein - "seine" Straftat wird nicht verfolgt. Dass der Täter wegen anderer Straftaten bestraft wird oder bestraft wurde, ist da manchmal nur ein schwacher Trost. Ändern lässt es sich trotzdem nicht - jedenfalls nicht mir formellen Rechtsbehelfen.